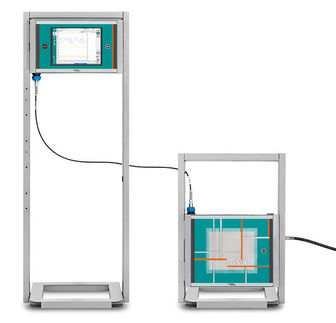Monoklonale Antikörper sind Antikörper, also immunologisch aktive Proteine, die von einer auf einen einzigen B-Lymphozyten zurückgehenden Zelllinie (Zellklon) produziert werden und die sich gegen ein einzelnes Epitop richten. Eine physiologisch vorkommende Immunantwort gegen ein in den Körper eingedrungenes Antigen ist dagegen stets polyklonal und richtet sich z. B. gegen viele verschiedene Teile auf einem Bakterium.
In der Diagnostik und Forschung spielen monoklonale Antikörper eine große Rolle, da sie mit hoher Spezifität verschiedenste Moleküle binden können. Die Bindung der Antikörper lässt sich dann mit unterschiedlichen Techniken nachweisen. Diese Antigen-Antikörper-Reaktion bildet die Grundlage für zahlreiche diagnostische Verfahren (z. B. Immunphänotypisierung, FACS, Immunhistologie, ELISA, ELISPOT, Radioimmunoassay und Western Blot).
Viele der von monoklonalen Antikörpern erkannten Zelloberflächenantigene menschlicher Zellen werden in der CD-Nomenklatur klassifiziert.
Herstellung monoklonaler Antikörper
Das Prinzip der Herstellung monoklonaler Antikörper geht auf César Milstein, Georges Köhler und Niels Jerne von 1975 zurück,[1] die dafür im Jahr 1984 den Nobelpreis für Medizin erhalten haben.[2] Die Technik beruht auf der Verschmelzung von Antikörper-produzierenden B-Zellen mit Zellen einer Myelom-Zelllinie, wodurch hybride Zellen entstehen, die unbegrenzt Antikörper einer bestimmten Spezifität produzieren (Hybridom-Technik).
Bei der Herstellung monoklonaler Antikörper gegen ein bestimmtes Antigen wird zunächst eine Maus mit diesem Antigen immunisiert (1, siehe Abbildung). Aufgrund der Immunantwort kommt es zur Bildung von B-Lymphozyten, die Antikörper bilden, welche mit dem Antigen reagieren und die sich in der Milz anreichern. Aus der entnommenen Milz (2) werden die B-Lymphozyten isoliert und mit Zellen (Plasmazellen) einer aus einem Myelom (Plasmozytom) gewonnenen Zelllinie (3) fusioniert (4), es entstehen sogenannte Hybridomzelllinien (5). Diese Hybridomzellen vereinigen Eigenschaften ihrer Ursprungszellen: vom B-Lymphozyt die Eigenschaft einen bestimmten Antikörper zu produzieren, von der Myelomzelle die Fähigkeit zu unbegrenztem Wachstum im Reagenzglas. Für die Gewinnung des monoklonalen Antikörpers wird die Hybridomzelllinie ausgewählt, die am besten das gewünschte Epitop auf dem Antigen bindet (6). Die unsterbliche Zelllinie wird aufbewahrt und der Zellüberstand wird regelmäßig bei Bedarf geerntet (7). Die Antikörper heißen monoklonal, weil sie aus einer einzigen Ursprungs-B-Zelle stammen und daher alle identisch sind.
Ein großer Fortschritt insbesondere zur Klonierung humaner Antikörper bildet die Technik des Phagen-Display.
Therapeutische monoklonale Antikörper
Die Versuche monoklonale Antikörper in der Therapie einzusetzen, waren zunächst nicht sehr erfolgreich. Die verwendeten Antikörper der Maus (murine Antikörper, Endung: -omab) wirken im menschlichen Organismus selbst als Antigen und können eine gegen sie gerichtete Immunantwort auslösen. Auch die für ihre erwünschte Wirkung wichtige Interaktion mit Zellen des Immunsystems des Empfängers war aufgrund der unterschiedlichen Spezies nicht optimal.
Wesentliche Fortschritte wurden erst gemacht, nachdem es in den letzten Jahren gelungen ist, modifizierte, den menschlichen Antikörpern besser angepasste monoklonale Antikörper zu entwickeln.
Terminologie der monoklonalen Antikörper
Nach Ähnlichkeit zu den menschlichen Antikörpern unterscheidet man (in aufsteigender Reihenfolge):
- murine Antikörper (von der Maus): Endung -omab
- Antikörper vom Primaten: Endung -imab
- chimäre Antikörper: Endung -ximab
- humanisierte Antikörper: Endung -zumab
- humane Antikörper: Endung -mumab
Zugelassene oder in klinischer Erprobung befindliche therapeutische monoklonale Antikörper
| Name
| Präparat
| Typ
| Zielstruktur
| Anwendungsgebiet
|
| Hämatologie, Onkologie
|
| Alemtuzumab
| MabCampath®
| humanisiert
| CD52-Antigen auf Lymphozyten
| Chronische lymphatische Leukämie, T-Zell-Lymphome2, akute lymphatische Leukämie2
|
| Apolizumab1,2
| Remitogen®
| humanisiert
| HLA-DR-Antigen auf B-Lymphozyten
| Solide Tumoren, akute lymphatische Leukämie, chronische lymphatische Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphome
|
| Bevacizumab
| Avastin®
| humanisiert
| VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
| Darmkrebs, Brustkrebs, nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom, feuchte, altersbedingte Makuladegeneration (Off-Label-Use)2
|
| Cetuximab
| Erbitux®
| chimär
| EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor)
| Darmkrebs, Kopf- und Halstumoren
|
| Eculizumab
| Soliris®
| humanisiert
| C5 Komplement-Faktor
| Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)
|
| Epratuzumab1,2
| LymphoCide®
| humanisiert
| CD22-Antigen
| Non-Hodgkin-Lymphome, Autoimmunerkrankungen, akute lymphatische Leukämie
|
| Galiximab1,2
| -
| chimär
| CD80-Antigen
| Non-Hodgkin-Lymphome
|
| Gemtuzumab1
| Mylotarg®
| humanisiert, Calicheamicin-beladen
| CD33-Antigen
| Akute myeloische Leukämie
|
| Ibritumomab-Tiuxetan
| Zevalin®
| murin, 90Y-markiert
| CD20-Antigen auf B-Lymphozyten
| Non-Hodgkin-Lymphome (Radioimmuntherapie)
|
| Lumiliximab1,2
| -
| chimär (Macaque/human)
| CD23-Antigen auf B-Lymphozyten
| Chronische lymphatische Leukämie
|
| Oregovomab1,2
| OvaRex®
| murin
| CA125
| Ovarialkarzinom
|
| Panitumumab1
| Vectibix®
| human
| EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor)
| EGF-Rezeptor exprimierende Tumoren, insb. metastasiertes kolorektales Karzinom
|
| Pertuzumab2
| Omnitarg®
| humanisiert
| Heterodimer Antikörper gegen den EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor) und den HER2/neu-Rezeptor
| Klinische Studien u.a. beim Ovarialkarzinom, Mammakarzinom, Bronchialkarzinom und Prostatakarzinom
|
| Rituximab
| MabThera®
| chimär
| CD20-Antigen auf B-Lymphozyten
| Non-Hodgkin-Lymphome
|
| Tositumomab1
| Bexxar®
| murin, 131I-markiert
| CD20-Antigen auf B-Lymphozyten
| Non-Hodgkin-Lymphome (Radioimmuntherapie)
|
| Trastuzumab
| Herceptin®
| humanisiert
| HER2/neu-Rezeptor
| Brustkrebs
|
| Zanolimumab1,2
| HuMax-CD4
| human
| CD4-Antigen auf T-Lymphozyten
| T-Zell-Lymphome
|
| Autoimmunerkrankungen, Transplantatabstoßung
|
| Adalimumab
| Humira®
| human
| TNF-α (Tumor Necrosis Factor α)
| Rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew, Morbus Crohn,
|
| Basiliximab
| Simulect®
| chimär
| CD25-Antigen (Interleukin-2-Rezeptor)
| Prophylaxe der akuten Abstoßungsreaktion bei Nierentransplantation
|
| Daclizumab
| Zenapax®
| humanisiert
| CD25-Antigen (Interleukin-2-Rezeptor)
| Prophylaxe der akuten Abstoßungsreaktion bei Nierentransplantation
|
| Epratuzumab1,2
| LymphoCide®
| humanisiert
| CD22-Antigen
| Autoimmunerkrankungen, Non-Hodgkin-Lymphome,
|
| Infliximab
| Remicade®
| chimär
| TNF-α (Tumor Necrosis Factor α)
| Morbus Crohn, Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, Psoriasis-Arthritis, Colitis ulcerosa
|
| Muromonab
| Orthoclon OKT3®
| murin
| CD3-Antigen auf T-Lymphozyten
| Behandlung der akuten Abstoßungsreaktion bei Nieren-, Herz- und Lebertransplantationen
|
| Natalizumab3
| Tysabri®
| humanisiert
| CD49d (α4-Integrin)
| Multiple Sklerose
|
| Tocilizumab1,2
| Actemra®
| humanisiert
| Interleukin 6
| Rheumatoide Arthritis
|
| Kardiovaskuläre Erkrankungen
|
| Abciximab
| ReoPro®
| chimär, Fab2-Fragment
| GPIIb/IIIa auf Thrombozyten
| Verhinderung eines Gefäßverschlusses nach PTCA
|
| Infektionskrankheiten
|
| Palivizumab
| Synagis®
| humanisiert
| Bestandteil des Respiratory Syncytial Virus (RSV)
| Prophylaxe der RSV-Pneumonie bei Frühgeborenen
|
| Augenheilkunde
|
| Ranibizumab
| Lucentis®
| humanisiert, Fab-Fragment
| VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor A)
| Feuchte Makuladegeneration
|
| Dermatologie
|
| Efalizumab
| Raptiva®
| humanisiert
| CD11a-Antigen
| Psoriasis
|
| Infliximab
| Remicade®
| chimär
| TNF-α (Tumor Necrosis Factor α)
| Psoriasis
|
| Allergische Erkrankungen
|
| Omalizumab
| Xolair®
| humanisiert
| IgE (Fc-Teil)
| Schweres Asthma bronchiale
|
| Zahnheilkunde
|
| CaroRx® 1,2
| CaroRx®
| rekombinant in Pflanzen hergestellt ("plantibody")
| spezifische Bindung an Streptococcus mutans (Leitkeim der Zahnkaries)
| als Mundspülung gegen Zahnkaries; Beseitigung von S. mutans aus der Mundflora (www.planetbiotechnology.com)
|
| Osteologie
|
| Denosumab (früher AMG 162)1,2,[1]
| –
| human
| RANK Ligand (Rezeptoraktivator des NFκB Liganden, RANKL)
| Osteoporose (Alternative zur Behandlung mit Bisphosphonat und Hormonen; inhibiert die Knochenresorption und erhöht die Mineraliendichte im Knochen)
|
1in Deutschland bisher nicht zugelassen (Stand 8/2007)
2in klinischer Prüfung
3Trotz möglicher seltener schwerer Nebenwirkungen von der FDA unter strengen Voraussetzungen wieder in den USA zugelassen, europäische Zulassung seit 6/2006.
Zur in-vivo-Diagnostik zugelassene monoklonale Antikörper
Zurückgezogene oder aufgegebene diagnostische monoklonale Antikörper
| Name
| Präparat
| Typ
| Zielstruktur
| Geplante Anwendungsgebiete
| Komplikationen und Kommentar
|
| Igovomab
| Indimacis 125
| murin, 111In markiert
| CA 125-Antigen
| ovarielle seröse Adenokarzinome
| 1999 auf Antrag der Herstellerfirma vom europäischen Markt genommen[3]. Begründung?
|
In präklinischer Prüfung oder Phase I/II-Studien befindliche therapeutische monoklonale Antikörper
| Name
| Präparat
| Typ
| Zielstruktur
| Anwendungsgebiet
|
| Cantuzumab
| –
| humanisiert, Mersantin-konjugiert
| CanAg (MUC1), Antikörper konjugiert mit Mersantin (Toxin)
| Darmkrebs, Magenkarzinom, Pankreaskarzinom, NSCLC
|
| Labetuzumab
| –
| humanisiert
| CEA (Carcinoembryonales Antigen)
| Darmkrebs, Pankreaskarzinom, Ovarialkarzinom
|
| Lumiliximab
| –
| humanisiert
| CD23
| Chronische lymphatische Leukämie, Asthma bronchiale
|
| Mepolizumab
| –
| humanisiert
| IL-5 (Interleukin-5)
| Hypereosinophilie-Syndrom
|
| Nimotuzumab
| TheraCim®
| humanisiert
| EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor)
| –
|
| Mapatumumab
| –
| human
| –
| Darmkrebs
|
| Matuzumab
| EMD72000
| humanisiert
| EGF-Rezeptor (Epidermal Growth Factor Receptor)
| Magenkrebs, Darmkrebs, NSCLC
|
| Pertuzumab
| Omnitarg®
| humanisiert
| HER2/neu
| Brustkrebs, Prostatakarzinom, Ovarialkarzinom, NSCLC
|
| R1450
| –
| human
| Amyloid-β
| Alzheimer-Krankheit
|
| 1D09C3
| –
| human
| MHC-II
| Non-Hodgkin-Lymphom (NHL)
|
Zurückgezogene oder aufgegebene therapeutische monoklonale Antikörper
| Name
| Präparat
| Typ
| Zielstruktur
| Geplante Anwendungsgebiete
| Komplikationen und Kommentar
|
| Nebacumab
| Centoxin®
| humanisiert (IgM)
| Endotoxin
| Sepsis
| Zulassung in Europa 1991, 1993 wegen erhöhter Sterblichkeit bei Patienten nach Behandlung mit Nebacumab im Vergleich zu Plazebo vom Markt genommen[4].
|
| Edrecolomab
| Panorex®
| Maus IgG2a
| EpCAM
| Darmkrebs
| Zulassung in Deutschland 1995, 2000 vom Markt genommen, da die bisherige Standardtherapie wirksamer war.
|
| TGN1412
| –
| humanisiert
| CD28
| Leukämie und Autoimmunerkrankungen (wie Multiple Sklerose und Rheuma)
| Zytokinsturm. In der öffentlichen Kritik standen Mängel in der Versuchsplanung und -durchführung, z.B. dass das Präparat an 6 Probanden gleichzeitig abgegeben wurde und die möglichen Nebenwirkungen offensichtlich unterschätzt wurden.
|
Quellen
- ↑ Köhler, G. & Milstein, C. (1975): Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. In: Nature. Bd. 256, S. 495-497. PMID 1172191. doi:10.1038/256495a0, Nachdruck in: J. Immunol. Bd. 174, S. 2453-2455. PMID 15728446 PDF
- ↑ Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1984 an César Milstein, Georges Köhler und Niels Jerne (englisch)
- ↑ Community list of not active medicinal products for human use, abgerufen am 5. August 2007
- ↑ NY Times Artikel zu Nebacumab
|