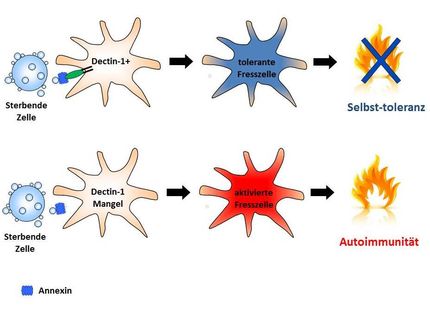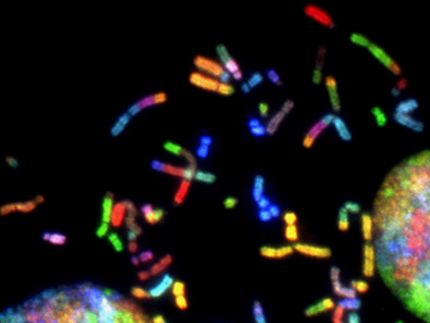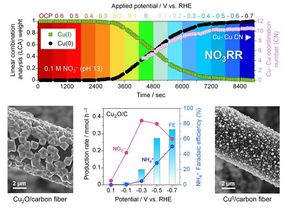Krebs: Kein Tumor ohne Kooperation
Anzeigen
Tumoren verschwinden, wenn man die für ihre Entstehung verantwortlichen Gene hemmt. Warum sie sich so verhalten, darüber existierten bisher nur Theorien. Einen konkreten Nachweis liefern jetzt Forscher der Universität Würzburg. Sie bestätigen damit einen lange gehegten Verdacht.
Krebs-Gene bilden den Bauplan für Proteine, die Zellen dazu veranlassen, sich ungebremst zu vermehren. Allerdings müssen diese Proteine in der Regel mit weiteren Partnern zusammenarbeiten, damit das Tumorwachstum einsetzt. Wird die Zusammenarbeit gestört, stellt der Tumor sein Wachstum ein.
Über die Gründe dafür, gibt es schon seit vielen Jahren eine Theorie und Befunde aus dem Reagenzglas. Nun ist es Wissenschaftlern der Universitäten Würzburg und Stanford erstmals am lebenden Organismus gelungen, diese Theorie zu bestätigen.
Die Rolle der Krebs-Gene
Jeder Mensch trägt in beinahe jeder Zelle seines Körpers eine bestimmte Gruppe von Genen, die eine wichtige Rolle bei der Krebsentstehung spielen - die so genannten Myc-Gene. Normalerweise werden diese Gene nur sehr wenig abgelesen; sie dienen als Bauplan für Myc-Proteine, die Aufgaben beim Zellwachstum übernehmen und nur in geringen Mengen gebraucht werden.
Arbeiten die Myc-Gene nicht so wie sie sollen, teilen sich Zellen unkontrolliert, ein Tumor entsteht. Diesen Ablauf hat das Wissenschaftler-Team genauer in Augenschein genommen. „Schon seit 1997 gibt es die Theorie, dass Myc-Proteine sich mit einem weiteren Protein - dem Miz1-Protein - verbinden und damit andere Gene regulieren, die für das Tumorwachstum von Bedeutung sind“, erklärt Martin Eilers.
Eilers ist Inhaber des Lehrstuhls für Physiologische Chemie II am Biozentrum der Universität Würzburg. Bereits 1988, in seiner Zeit als Postdoc in San Francisco, hat er damit begonnen, die Myc-Gene und -Proteine zu erforschen. 1997 gehörte er zu dem Wissenschaftler-Team, das die Theorie der Protein-Zusammenarbeit entwickelte.
Jetzt ist es zwei Doktoranden in seiner Gruppe, Judith Müller und Tobias Otto, gelungen, gemeinsam mit Kollegen der Stanford University (Kalifornien) diese Theorie am lebenden Organismus zu bestätigen.
Eine Genmutation sorgt für weniger Krebserkrankungen
„Tumorzellen sind auf ständige Unterstützung durch die für sie verantwortlichen Gene angewiesen“, sagt Eilers. Fehlt diese Unterstützung, bricht die Tumorzelle zusammen. „Die Gründe dafür hat man bisher nie genau verstanden“, so der Wissenschaftler. Eine Erklärung liefert die Myc-Miz-Kollaboration.
„Tumorzellen tragen in sich ein Programm, das sie eigentlich daran hindert, sich ungebremst zu vermehren“, erklärt Martin Eilers. Oder, etwas anders formuliert: Die Tumorzelle neigt zum Selbstmord beziehungsweise zur Arbeitsverweigerung. So kann sie zum einen den programmierten Zelltod starten - eine geschädigte Zelle bringt sich um und bewahrt damit den gesamten Organismus vor größerem Schaden. Wissenschaftler sprechen in diesem Fall von Apoptose. Oder die Zelle stoppt ihren Lebenszyklus, teilt sich nicht mehr, bleibt aber weiterhin stoffwechselaktiv. Der Fachausdruck dafür lautet Seneszenz.
Erst die Wechselwirkung mit dem Miz1-Protein verhindert die Seneszenz. Der Nachweis dafür gelang den Wissenschaftlern, als sie das Myc-Gen an einer Stelle umbauten. Das dementsprechend veränderte Protein war deshalb kaum noch in der Lage, an Miz1 zu binden. Gleichzeitig traten bei den Versuchstieren, die das mutierte Gen trugen, deutlich weniger Krebsfälle auf. Eigentlich ein kurioses Ergebnis: Ein mutiertes Gen senkt die Zahl der Tumoren. Denn normalerweise sind gerade Genmutationen für eine Vielzahl von Krebsfällen verantwortlich.
Proteine müssen zusammenarbeiten
Warum es in diesem Fall nicht so ist? „Myc muss an Miz1 binden. Nur dann kann es verhindern, dass die Zelle bestimmte Faktoren bildet, die das Tumorwachstum verhindern“, erklärt Martin Eilers. Erst wenn Myc und Miz zusammenarbeiten, sind sie in der Lage, die Zelle zum ständigen Wachstum zu treiben. Nur gemeinsam können sie die Zelle daran hindern, ihr normales Alterungsprogramm abzuspulen.
Direkte Konsequenzen für eine Krebstherapie hat die Erkenntnis der Wissenschaftler aus Würzburg und Stanford nicht. Als möglicher Angriffspunkt eigne sich der Myc-Miz-Verbund derzeit noch nicht - dazu sei das Geschehen zu komplex. „Wir wissen noch zu wenig über seine physiologische Bedeutung so Eilers. Deshalb will Eilers mit seinem Team in einem nächsten Schritt versuchen, die Rolle der Wechselwirkung beider Proteine in der normalen Entwicklung aufzuklären.
Originalveröffentlichung: Jan van Riggelen et al.; "The interaction between Myc and Miz1 is required to antagonize TGFb-dependent autocrine signaling during lymphoma formation and maintenance"; Genes & Development 2010