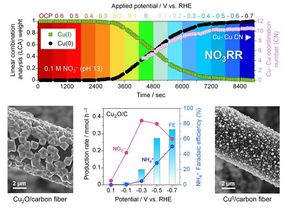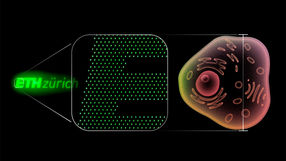Wie durchlässig ist die Plazenta?
Empa-Forscher untersuchen Transport von Nanopartikeln im menschlichen Körper
Anzeigen
Ob und wie freie Nanopartikel im menschlichen Körper wirken, darüber bestehen noch große Wissenslücken. So ist wenig darüber bekannt, ob schwangere Frauen die winzigen Teilchen - einmal aufgenommen - an das ungeborene Kind weitergeben. Wissenschaftler der Empa und des Universitätsspitals Zürich präsentieren nun erste Resultate.
Nanotechnologie bietet sich nicht nur an, anstehende Herausforderungen in Medizin, Energieversorgung oder Umweltschutz zu meistern; sie gilt auch als Innovationsmotor für die Schweizer Wirtschaft. Doch die Nanotechnologie wird nur dann erfolgreich sein, wenn potenzielle Risiken - etwa von freien Nanopartikeln - genau unter die Lupe genommen werden.
Die Empa untersucht bereits seit einiger Zeit die Auswirkungen verschiedenster Nanopartikel auf menschliche Zellen und Gewebe. Diese Sicherheitsforschung dient dem besseren Verständnis dafür, was Nanopartikel im menschlichen Körper (und in der Umwelt) «anrichten» können - aber auch, was nicht. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift «Environmental Health Perspectives» veröffentlichten Studie konzentrierte sich das Team von Empa-Forscher Peter Wick, zusammen mit Medizinern des Universitätsspitals Zürich um Ursula von Mandach, auf ein besonderes Organ: die menschliche Plazenta. Diese ist sozusagen der Filter zwischen Mutter und ungeborenem Kind und stellt sicher, dass der Fötus mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wird, aber auch, dass die Blutkreisläufe sich nicht vermischen. Die Forscher wollten wissen, ob Nanopartikel die Plazentabarriere überwinden können.
Barriere für Nanopartikel bestimmt
Gängige Tiermodelle wie Mäuse oder Ratten fielen weg, da deren Plazenta grundlegend anders aufgebaut ist als die menschliche. Das Spezielle an diesem Organ ist, dass es nach der Geburt nicht mehr gebraucht und deshalb ausgestoßen wird. Mehrere Mütter, die am Universitätsspital Zürich ihr Kind zur Welt gebracht hatten, stellten nach der Geburt ihre Plazenta der Forschung zur Verfügung. In diesen «gespendeten» Organen lässt sich für einige Stunden im Labor sowohl der mütterliche als auch der fötale Kreislauf aufrecht erhalten.
Für ihre Studie brachten die Forscher fluoreszierende Nanopartikel aus Polystyrol in den Mutterkreislauf ein und beobachteten, ob diese in den fötalen Kreislauf gelangen. «Diese Polystyrolpartikel eignen sich dafür besonders gut, da sie im Gewebe keinen Stress auslösen und einfach nachweisbar sind», sagt Wick.
Injiziert wurden Partikel verschiedener Größe, von 50 Nanometer bis zu einem halben Mikrometer Durchmesser. Fazit der Studie: «Der Cutoff lag zwischen 200 und 300 Nanometern», so Wick. Partikel, die kleiner waren, gingen durch die Plazenta in den Kindskreislauf über, größere Partikel wurden dagegen zurückgehalten.
Nächster Schritt: Verständnis der Transportmechanismen
Dass Nanopartikel unterhalb einer bestimmten Größe in die Blutbahn des ungeborenen Kindes gelangen können, sei nicht unerwartet und müsse nun weiter erforscht werden. Wick: «Als nächstes müssen wir den Mechanismus verstehen lernen, wie die Partikel durch die Plazenta - und zwar in beide Richtungen - transportiert werden.»
Diese Erkenntnisse könnten auch der Medikamentenforschung nützen. Medizinische Behandlungen bei schwangeren Frauen müssen immer mit dem Dilemma umgehen, dass beide Organismen - Mutter und Kind - von der Therapie betroffen sind, auch wenn nur einer von beiden behandelt werden soll. Ein detailliertes Verständnis der Transportmechanismen durch die Plazenta könnte neue Möglichkeiten schaffen, wie Medikamente gezielter in den Kreislauf des ungeborenen Kindes geschleust werden können. So könnten Nanopartikel etwa als Transportvehikel für bestimmte Wirkstoffe dienen.
Originalveröffentlichung: Peter Wick et al.; «Barrier Capacity of Human Placenta for Nanosized Materials»; Environmental Health Perspectives, Volume 118, Number 3, March 2010