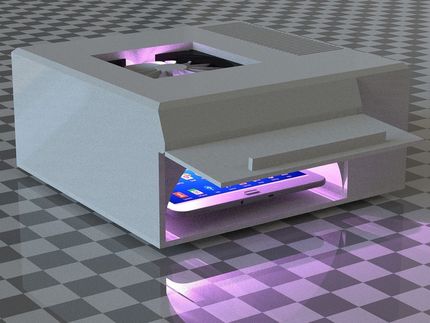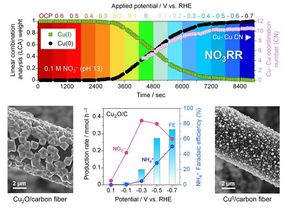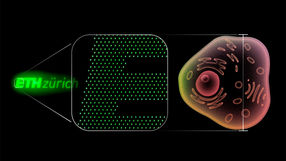Putzen mit Bakterien?
Einfluss verschiedener Reinigungsregimes auf die Menge, Vielfalt und Resistenzen der Bakterien, die auf den Oberflächen von Klinikzimmern zu finden sind
Anzeigen
Ein Forschungsteam aus Jena und Berlin untersuchte den Einfluss verschiedener Reinigungsregimes auf die Menge, Vielfalt und Resistenzen der Bakterien, die auf den Oberflächen von Klinikzimmern zu finden sind. Bei der Anwendung eines probiotischen Reinigungsmittels kam es zu signifikanten Veränderungen der Bakterienflora der Krankenzimmer, insbesondere in den Waschbecken. Während im Vergleich zur Desinfektionsreinigung die Menge der üblichen Umgebungsmikroben abnahm, führte die probiotische Strategie außerdem zu einer erhöhten Artenvielfalt und zu einer Reduktion der Gensequenzen, die Resistenzen gegen Antibiotika vermitteln.

Ein Forschungsteam aus Jena und Berlin untersuchte den Einfluss verschiedener Reinigungsregimes auf Menge - Vielfalt und Resistenzen der Bakterien auf den Oberflächen in Klinikzimmern.
Uta von der Gönna/UKJ - Universitätsklinikum Jena
Im vergangenen Jahr beschrieb ein Forschungsteam aus Jena und Berlin, wie in den Stationszimmern eines Klinikneubaus die von den Patienten mitgebrachten Bakterien die Umweltkeime nach und nach verdrängen und sich auf Türklinken, im Waschbecken und auf dem Fußboden ein jeweils typisches Keimspektrum ausbildete. Dabei untersuchte das Team auch das Auftreten von jenen Gensequenzen, die Antibiotikaresistenzen vermitteln. Besonders auf dem Fußboden sammelten sich diese in potenziell resistenten Stämmen an. Mit seiner jetzt in der Fachzeitschrift Clinical Microbiology and Infection erschienenen Folgearbeit analysierte das Team den Einfluss verschiedener Reinigungs- bzw. Desinfektionsmethoden auf die Bakterienflora in Klinikzimmern. Die Studie wurde im Rahmen des InfectControl2020 Verbundes vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
„Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln auf Oberflächen wird zunehmend hinterfragt, ob die desinfizierende Wirkung zeitlich sehr begrenzt sein könnte, und ob sie gegebenenfalls sogar die Verbreitung von Resistenzen begünstigen könnte“, sagt PD Dr. Rasmus Leistner vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin zum Hintergrund der Studie. Es gibt Untersuchungen, die eine erneute Besiedelung von Oberflächen bereits eine halbe Stunde nach der desinfizierenden Reinigung nachweisen. Deshalb analysierte das Forschungsteam mit seiner Methodik, ob und wie sich die Bakterienbesiedlung von Türklinke, Fußboden und Waschbecken ändert, wenn das Reinigungsmittel gewechselt wird.
Nacheinander führte es für je 13 Wochen die tägliche Flächenreinigung in neun Zimmern einer neurologischen Station der Charité mit üblichem Desinfektionsmittel, mit Haushaltsreiniger und mit einem probiotischen Reinigungsmittel durch, das mit verschiedenen Stäbchenbakterien angereichert ist. Nach einer sechswöchigen Umstellungszeit nahm das Team dann wöchentlich Abstrichproben von Türklinke, Fußboden und Waschbecken. Auch von den Patientinnen und Patienten in den Zimmern wurden Nasen- und Rektalabstriche genommen. Mit Hilfe von Sequenzierungsverfahren und PCR-Analysen bestimmte das Projektteam die Menge der Bakteriengemeinschaften und deren Artenzusammensetzung.
In Bestätigung der früheren Ergebnisse fand das Team im Waschbecken die größte Bakterienmasse, gefolgt von der Türklinke. Im Vergleich der Reinigungsarten zeigte sich die jeweils ortstypische Umgebungsbesiedlung bei der probiotischen Reinigung jeweils leicht verringert, für das Waschbecken war der Effekt sogar deutlich. Die Auswertung der Mikrobenvielfalt ergab auf der Ebene der Bakterienfamilien zunächst die bereits zuvor gefundenen typischen Verteilungen für die drei Messorte, weitgehend unabhängig von der Art der Reinigung. Bei der Betrachtung der vorkommenden Arten und Stämme wurden aber Unterschiede deutlich: Im Vergleich zur probiotischen Reinigung führte die Desinfektion auf den untersuchten Oberflächen zu einer deutlich geringeren Mikrobenvielfalt. „Wir beobachten in den Krankenzimmern eine signifikante Verschiebung der Umgebungsmikrobiota nach Anwendung einer probiotischen Reinigungsstrategie. Die daraus resultierenden Strukturen der mikrobiellen Ökosysteme sind komplexer und stabiler“, so Erstautor Dr. Tilman Klassert von der Arbeitsgruppe Host Septomics am Universitätsklinikum Jena. Das Patientenscreening belegte, dass dieser Effekt tatsächlich von den Putzregimes herrühren musste.
Das Studienteam erfasste in den Proben auch zwölf Gensequenzen, die eine Resistenz gegen Antibiotika vermitteln. Durch die probiotische Reinigung traten Mikroben mit solchen Genen im Waschbecken deutlich seltener auf. Die Jenaer Arbeitsgruppenleiterin Prof. Dr. Hortense Slevogt: „Der interessanteste Effekt, den das probiotische Reinigungsregime bewirkte, war eine signifikante Reduktion insbesondere jener Antibiotikaresistenzgene, die in den multiresistenten MRSA-Bakterien gefunden werden.“
Mit seinen Ergebnissen kann das Forschungsteam erstmals den positiven Effekt eines probiotischen Reinigungsregimes in einer realen klinischen Umgebung quantitativ belegen. Damit stützt es den Ansatz, dass der gezielte Einsatz von für den Menschen unbedenklichen Bakterien eine stabile Mikrobenvielfalt fördert und einer bevorzugten Besiedlung mit gefährlichen Krankheitserregern entgegenwirken kann. „Die Ergebnisse unserer Studie sind vielversprechend und sollten nun in randomisierten klinischen Studien validiert werden“, verweist Prof. Dr. Petra Gastmeier, Direktorin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité auf weiteren Forschungsbedarf.
Originalveröffentlichung
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft
Meistgelesene News
Weitere News von unseren anderen Portalen
Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten
Themenwelt PCR
Diese bahnbrechende und äußerst vielseitige molekulare Technik der PCR erlaubt es uns, winzige Mengen genetischen Materials in großem Umfang zu vervielfältigen und detailliert zu analysieren. Ob in der medizinischen Diagnostik, der forensischen DNA-Analyse oder der Erforschung genetischer Krankheiten - die PCR ist ein unverzichtbares Werkzeug, das uns tiefe Einblicke in die Welt der DNA gewährt. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Polymerasekettenreaktion (PCR)!
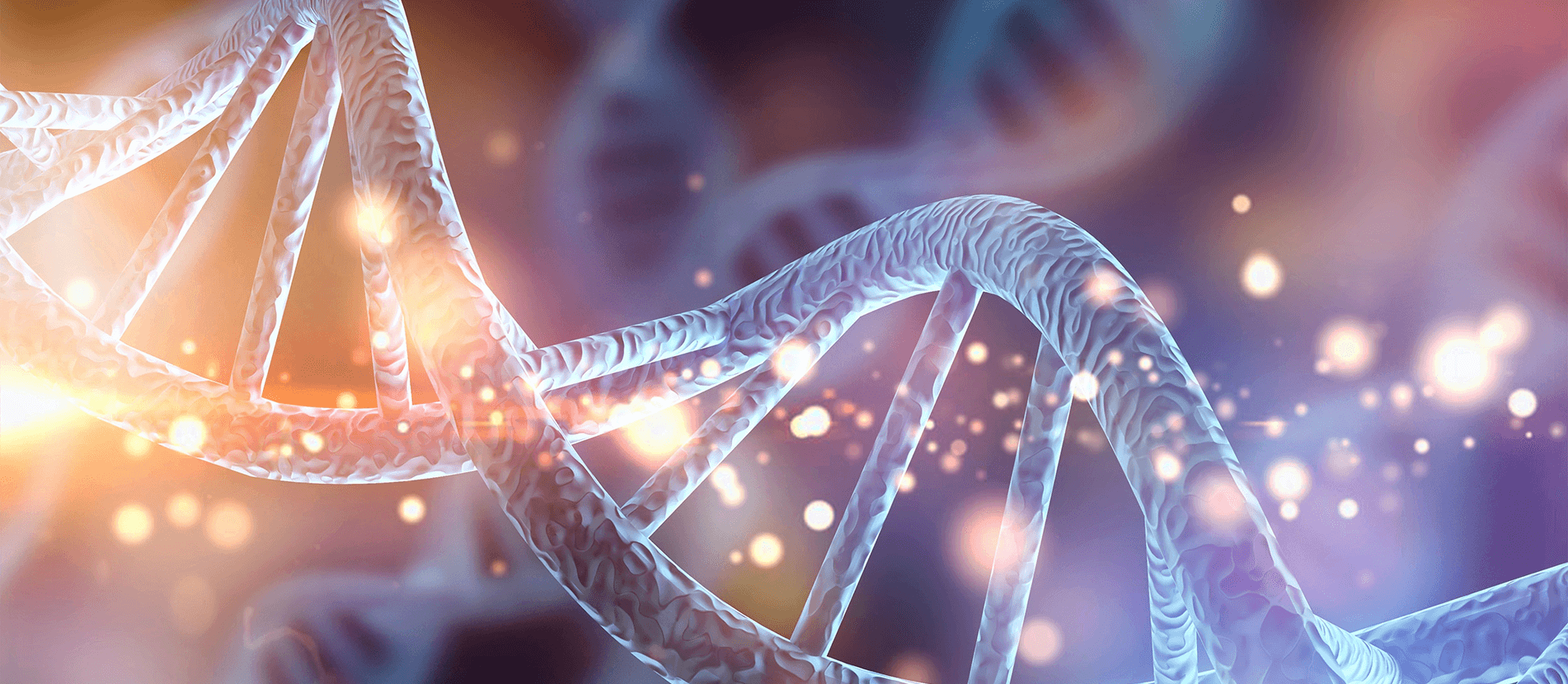
Themenwelt PCR
Diese bahnbrechende und äußerst vielseitige molekulare Technik der PCR erlaubt es uns, winzige Mengen genetischen Materials in großem Umfang zu vervielfältigen und detailliert zu analysieren. Ob in der medizinischen Diagnostik, der forensischen DNA-Analyse oder der Erforschung genetischer Krankheiten - die PCR ist ein unverzichtbares Werkzeug, das uns tiefe Einblicke in die Welt der DNA gewährt. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Polymerasekettenreaktion (PCR)!