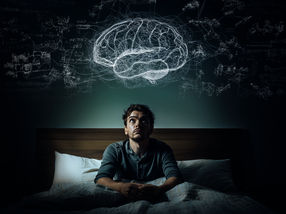Helicobacter pylori kann sein Erbgut in geradezu rasanter Geschwindigkeit verändern.
Bericht in den "Proceedings of the National Academy of Sciences USA" (PNAS)
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist mit Helicobacter pylori infiziert. Die Erreger schaffen es, die durch die Magensäure und eine zähe Schleimschicht vor anderen Bakterien geschützte Magenschleimhaut zu besiedeln und diese Infektion trotz einer intensiven Abwehrreaktion des Menschen jahrzehntelang aufrecht zu erhalten.
Helicobacter ruft bei allen Infizierten eine chronische Entzündung der Magenschleimhaut hervor. Bei 10 bis 15 Prozent der Betroffenen kommt es zu Folgeerkrankungen, oft zu schmerzhaften Magengeschwüren, in selteneren Fällen zu Magenkrebs.
Die Würzburger Mikrobiologen Sebastian Suerbaum und Christian Kraft vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität haben jetzt in Zusammenarbeit mit Daniel Falush und Mark Achtman vom Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin sowie mit zwei Instituten in den USA eines der Erfolgsgeheimnisse dieser Bakterien identifiziert: Sie konnten zeigen, dass Helicobacter sein Erbmaterial während der chronischen Infektion eines Patienten mit hoher Geschwindigkeit verändert.
Die Autoren der Studie, die in der kommenden Ausgabe der amerikanischen Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences USA" (PNAS) erscheinen wird, haben Paare von H. pylori-Stämmen untersucht, die im Abstand von minimal drei Monaten bis zu maximal vier Jahren aus ein und demselben Patienten isoliert wurden. Durch die Analyse von Stichproben des Bakterienerbguts konnten sie bei 11 der 24 Stammpaare bereits nach der kurzen Zeit von durchschnittlich 1,8 Jahren Veränderungen des Erbguts nachweisen.
Mit einem eigens für diese Untersuchung entwickelten mathematischen Modell haben die Wissenschaftler berechnet, dass sich das Erbgut der Bakterien im Verlauf eines Infektionsjahres rund 60 Mal verändert. So können die Bakterien innerhalb von nur 41 Jahren die Hälfte ihres Erbguts austauschen - "eine verglichen mit anderen Bakterien enorm hohe genetische Flexibilität", so Prof. Suerbaum. Die genetischen Veränderungen kommen dadurch zu Stande, dass die Bakterien kleine Stücke der DNS von einem anderen Helicobacter pylori-Stamm aufnehmen und dann mit ihrem eigenen Erbgut vereinigen.
Die in diesem Ausmaß noch nie beschriebenen dynamischen Veränderungen des Erbguts helfen dem Erreger wahrscheinlich, sich immer wieder neu an den Menschen anzupassen, der ihn beherbergt. Die Wissenschaftler mahnen an, dass die enorme genetische Flexibilität von Helicobacter bei der Entwicklung von Impfstoffen und neuen Therapeutika beachtet werden müsse, damit die Erreger die neuen Substanzen nicht sofort unterlaufen können.
Meistgelesene News
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.