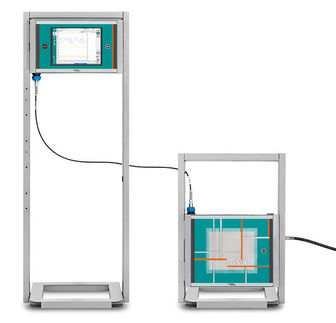Um alle Funktionen dieser Seite zu nutzen, aktivieren Sie bitte die Cookies in Ihrem Browser.
my.bionity.com
Mit einem my.bionity.com-Account haben Sie immer alles im Überblick - und können sich Ihre eigene Website und Ihren individuellen Newsletter konfigurieren.
- Meine Merkliste
- Meine gespeicherte Suche
- Meine gespeicherten Themen
- Meine Newsletter
Mendelsche RegelnDie mendelschen Regeln wurden benannt nach ihrem Entdecker Gregor Mendel und beschreiben, wie die Vererbung von Merkmalen abläuft, deren Ausprägung von (nur) einem Gen bestimmt wird. Klassische, bereits von Mendel untersuchte Beispiele für solche Merkmale sind die Form und die Farbe von Erbsensamen und die Farbe von Erbsenblüten. Auch die Blutgruppen des Menschen gehören dazu. Die Regeln gelten nur für diploide Organismen (also solche, die von beiden Eltern je einen Chromosomensatz erben) mit haploiden Keimzellen. Dazu zählen die Menschen, die meisten höheren Tiere und viele Pflanzen. Es lassen sich ebenfalls Regeln für Organismen mit höherem Ploidiegrad ableiten. Die frühere Bezeichnung mendelsche Gesetze ist ungebräuchlich geworden, da mehrere genetische Phänomene entdeckt wurden – beispielsweise Translokationen und die so genannten Springenden Gene − aufgrund derer ein Erbgang von den „Regeln“ abweichen kann. Produkt-Highlight
EntdeckungDie mendelschen Regeln wurden in den 1860er-Jahren von dem naturwissenschaftlich interessierten Augustinermönch Gregor Mendel durch Kreuzungsversuche an Erbsenpflanzen ermittelt und in einer zunächst wenig beachteten Publikation[1] formuliert. Mendel führte dafür die Begriffe „rezessiv“ und „dominierend“ ein (statt des letzteren wird heute „dominant“ verwendet). Erst 1900 wurden seine Erkenntnisse von den Botanikern Carl Correns (Tübingen), Erich Tschermak-Seysenegg (Wien), William Bateson (London) und Hugo de Vries (Amsterdam) unabhängig voneinander wiederentdeckt. Zwischenzeitlich waren die Chromosomen und ihre Verteilung an die Nachkommen beschrieben worden, so dass die mendelschen Regeln jetzt mit der Chromosomentheorie der Vererbung in Verbindung gebracht werden konnten. Heute gehören sie zum Gemeingut der klassischen Genetik. Mendel entdeckte Gesetzmäßigkeiten, die anderen zuvor verborgen geblieben waren. Der Erfolg seiner Untersuchungen lässt sich im Nachhinein mit folgenden Faktoren begründen:[2]
Die mendelschen RegelnDie folgenden Regeln wurden ursprünglich durch Beobachtung und statistische Analyse festgestellt. Ihr Verständnis wird jedoch stark erleichtert, wenn man sich vor Augen hält, dass die betroffenen Merkmale von (nur) einem Gen (Erbanlage) festgelegt werden, welches in zwei Kopien vorliegt, von denen je eine von einem Elternteil vererbt wurde. Regel 1: UniformitätsregelDiese Regel (auch Reziprozitätsregel genannt) gilt, wenn zwei Individuen („Eltern-“ oder Parentalgeneration P genannt) gekreuzt werden, die sich in einem Merkmal unterscheiden, für das sie beide jeweils homozygot (reinerbig) sind: Die Nachkommen der ersten Generation („Kinder“ oder erste Filialgeneration F1 genannt) sind dann uniform, d. h. bezogen auf das untersuchte Merkmal untereinander gleich. Dies gilt für den Phänotyp (äußeres Erscheinungsbild) wie den Genotyp (Erbausstattung), welcher bei allen heterozygot (mischerbig) ist. Dabei ist es egal, welches der beiden Merkmale von der Mutter und welches vom Vater vererbt wird (reziproke Kreuzung). Für die Ausprägung des Merkmals tritt eine von zwei Möglichkeiten ein.
Ausnahmen von der 1. Regel können auftreten, wenn sich das Gen für ein untersuchtes Merkmal auf einem Geschlechtschromosom (Gonosom) befindet. Dann kann es sein, dass die F1-Generation nicht uniform ist. Regel 2: SpaltungsregelDiese Regel (auch Segregationsregel genannt) gilt, wenn zwei Individuen gekreuzt werden, die beide gleichartig heterozygot sind, also z. B. zwei Pflanzen, die für die Blütenfarbe beide die beiden Erbanlagen „weiß“ und „rot“ haben. Das kann etwa die F1-Generation des vorherigen Abschnitts sein. In Beschreibungen der mendelschen Regeln werden die Nachkommen einer solchen Heterozygoten-Kreuzung daher meist als Enkel oder zweite Filialgeneration, F2, bezeichnet. Diese Nachkommen sind untereinander nicht mehr uniform, sie spalten sich bezüglich der Merkmalsausprägung auf. Dabei kommen die Merkmale der P-Generation (siehe vorheriger Abschnitt) wieder zum Vorschein:
Regel 3: Unabhängigkeitsregel/NeukombinationsregelDiese Regel beschreibt das Vererbungsverhalten von zwei Merkmalen (z. B. Samenfarbe und Samenform) bei der Kreuzung reinerbiger Individuen und deren Nachkommen. Diese zwei Merkmale werden getrennt voneinander vererbt, wobei ab der F2-Generation („Enkel“) neue, reinerbige Kombinationen auftreten können (siehe Abbildung 3). Diese Regel gilt allerdings nur dann, wenn sich die für die Merkmale verantwortlichen Gene auf verschiedenen Chromosomen befinden oder wenn sie auf dem gleichen Chromosom so weit voneinander entfernt liegen, dass sie während der Meiose durch Crossing over regelmäßig getrennt voneinander vererbt werden (polygene Erbgänge). Befinden sich Gene auf dem gleichen Chromosom nahe beieinander, so werden sie in Kopplungsgruppen vererbt.
Genetische HintergründeMendel kannte weder den Begriff der Gene noch den der Chromosomen. Die stoffliche Grundlage der Erbanlagen war ihm somit nicht bekannt. Erst 1904 wurde durch Sutton und Boveri die Chromosomentheorie der Vererbung begründet. Mit Hilfe dieser Theorie können die Mendelregeln widerspruchsfrei erklärt werden. In den Körperzellen treten die Chromosomen paarweise auf. So besitzt der Mensch 23 Chromosomenpaare, also 46 Chromosomen. Man spricht von einem doppelten oder diploiden Chromosomensatz. Ein Chromosomensatz stammt vom Vater und einer von der Mutter. Die Chromosomen eines Paares werden auch als homologe Chromosomen bezeichnet. In einer Körperzelle sind die Erbanlagen pro Merkmal somit immer doppelt vorhanden. Bei der Bildung der Geschlechtszellen werden die homologen Chromosomenpaare in der Meiose getrennt. In einem Ei bzw. einem Spermium (Geschlechtszelle) befindet sich also nur der einfache Chromosomensatz, die Erbanlagen pro Merkmal (Genabschnitte) sind somit immer nur einmal vorhanden. Dies erklärt die Spaltungsregel. Bei der Befruchtung, also der Verschmelzung von Ei und Spermium, bringen beide Geschlechtszellen jeweils eine Erbanlage pro Merkmal mit. Die durch diese Verschmelzung entstehende Körperzelle (Zygote) hat also wieder den doppelten Chromosomensatz. Die Erbanlagen können so neu kombiniert werden (Unabhängigkeitsregel, freie Kombination der Gene). Der Nutzen dieser Rekombination – also der sexuellen Vermehrung – liegt darin, dass mehr verschiedene Genkombinationen zur Evolution beitragen. Ohne sexuelle Vermehrung gäbe es von jedem Lebewesen nur weitgehend identische Kopien. Mit sexueller Vermehrung gibt es eine hohe Bandbreite an Nachkommen, und damit an Überlebensstrategien und -möglichkeiten. Dazu kommt, dass Fehler oder Schwächen im Erbgut bei sexueller Vermehrung sehr ungleichmäßig auf die Nachkommen verteilt sind, sodass einige Nachkommen deutlich weniger Probleme haben als ihre Eltern, und damit ein Ausgleich für Fehler beim Kopieren der Erbinformationen geschaffen wird. Außerdem ermöglicht die sexuelle Vermehrung die Übernahme der besten Eigenschaften zweier zeitweise getrennter Populationen in eine gemeinsame Population und damit auch eine schnellere Aneignung von Fähigkeiten, die woanders vorher schon entstanden sind. Insbesondere bei neuen Genen (z. B. Malariaresistenz) tritt auch das Phänomen auf, dass ein Gen mit Nebenwirkungen (in diesem Fall Sichelzellenanämie) nicht alle ihre Träger krank macht, sodass der Vorteil trotz Nachteilen („Unausgereiftheit“ der Mutation) vererbt werden kann. Unter „natürlichen“ Bedingungen (Selektion zugunsten der Gesünderen) sollten weitere Mutationen nach einigen Generationen dazu führen, dass die Nachteile weniger werden. Der technologische Fortschritt verlagert diese Entwicklung aber mehr und mehr in die Medizin. AnwendungDie mendelschen Regeln werden insbesondere in der Tier- und Pflanzenzucht angewendet, z. B. bei der Zucht von Hybriden. Sie können auch für Abstammungsgutachten verwendet werden, z. B. um nachzuweisen, dass bestimmte Menschen nicht als Elternteil eines bestimmten Kindes in Frage kommen. Quellenangaben
Literatur
|
|||||
| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Mendelsche_Regeln aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |